
Pützborn – Ort mit ‚wildem Park‘
Alois Mayer, Pützborn
Acht Kilometer ist der Pützbach von seiner Quelle bei Waldkönigen nun schon geflossen. Zwei Kilometer hat er noch, bis er in Gemünden sich mit der Lieser vereinigt. Und auf den wenigen Kilometern hat der Bach bereits viel gesehen und erlebt, seltene Pflanzen und gaukelnde Schmetterlinge, bunte Eisvögel und zahlreiche Fischreiher. Er hatte Wasser für drei heute stillgelegte Mühlen geliefert, lernte drei beschauliche Dörfer kennen, floss an vielen Dreesen und Sauerbrunnen vorbei und ist nun angekommen in dem Dorf, das einen doppelt gemoppelten Namen hat: ‚Pütz-‚ (Pfütze, Brunnen) und ‚-born‘ (Brunnen). Auch in diesem Dorf hatte der schmale Bach noch bis in die 1950er Jahre eine Mühle betrieben. Ebenfalls spendete er Wasser für eine dereinst bedeutende Schmiede gespendet, die in alle Welt Forstwerkzeuge lieferte, und aus der danach eine Gaststätte und heute ein Miethaus wurde. Der Pützbach und die vielbefahrene Bundesstraße zweiteilen den Ort, der seit 1969 nach Daun eingemeindet und heute mit über 1200 Einwohnern der größte Stadtteil ist. Seit Jahren entwickelt er sich verstärkt zu einem beliebten Gebiet für Neubauten und gewerbliche Unternehmen.
Pützborner als Leibeigene
Pützborn ist sehr alt. Das Tal gefiel schon den Römern und Kelten, von denen beim Wegebau in Richtung Gemünden Gräber mit Beigaben gefunden wurden.
1220 wurde das Dorf, auch wenn es nur wenige Häuser hatte, urkundlich erwähnt. Es gehörte damals dem Grafen von Vianden. Weil dieser freundschaftliche Beziehungen zu den Manderscheidern unterhielt, gab er denen auch die Hälfte des Ortes - Pützbair wie er damals hieß - zu Lehen. Um die andere Hälfte stritten sich mehrere Herrschaften. Nicht weil die Häuser besonders hübsch waren, sondern weil die Herren von den Zehntabgaben der Bauern lebten und diese Fron- und unter Umständen auch Kriegsdienste leisten mussten. 1544 forderte der Trierer Erzbischof dies ausdrücklich. „Die Leute von Newkirch und Botzbur sollen in der Leibeigenschaft bleiben.“
Noch 1562 ist davon die Rede, daß "zwye halbe dorffern, Nuynkirchen und Putzbor" mit allem Zubehör dem Manderscheider Grafen Diedrich VI. persönlich auf dem Viandener Schloß 'ausgeliehen' wurde. Als das Manderscheider-Schleidener-Virneburger Geschlecht im Mannesstamme ausstarb, gelangte das halbe Dorf im Laufe der kommenden Jahrhunderte und nach vielen Streitigkeiten in den Besitz der Herzöge von Aremberg. Bei diesen verblieb es dann bis zur französischen Revolution 1794, die alle Macht- und Besitzverhältnisse im Eifelraum änderte.
Nicht nur die Besitzer wechselten und wandelten sich, auch der Ortsname: Buczvure (1344), Betzborn (1389), Putzbair (1489), Botzbur (1544), Putzbor (1562) bis zum heutigen Dialektwort ‚Betzber‘ für Pützborn.
Schöne, alte und typische Eifel-Fachwerkhäuser sind nicht mehr zu finden. Die, die dereinst dort standen, wurden alle Raub von Flammen, als 1796 Pützborn total abbrannte. Nur eine einzige Hütte und das Kirchlein blieben bestehen.
Mühselig aufgebaut, verbrannte das Dorf wieder größtenteils in den Jahren 1853 und 1880.
Kapelle mit Bauernmalerei
Wenn Sie nach Pützborn kommen, das 1969 in die Stadt Daun eingemeindet wurde, besuchen Sie nicht nur die Geschäfte oder den bekannten Wild- und Erlebnispark, sondern auch die Dorfkirche, ein Kleinod bäuerlicher Baukunst.
Wann das allererste Gotteshaus errichtet wurde, ist nicht hundertprozentig bekannt. Mit Sicherheit stand es aber bereits 1666, wenige Jahre nach dem schrecklichen Dreißigjährigen Krieg, der Pützborn über die Hälfte aussterben ließ. Ein alter, fast schwarzer Opferstock, aus einem Baumstamm gehauen, mit der Jahreszahl 1666 und dem Symbol (= ein stilisiertes Jagdhorn) des Kapellenpatrons Hubertus steht noch heute am Eingang der Kirche.
Als nun diese über hundert Jahre später baufällig geworden war - 'ruinosa' steht in den Unterlagen -, wandte sich der aus Pützborn stammende Pastor Johann Eyden 1788 an das Kölner Generalvikariat (Pützborn gehörte bis 1803 zur Erzdiözese Köln !) und teilte mit, dass die arme Pützborner Bevölkerung nicht in der Lage sei, einen Kapellenbau gänzlich zu finanzieren. Daraufhin erhielt Eyden am 24. Oktober 1788 vom Generalvikar die Erlaubnis, aus den Einkünften und dem Vermögen der Kapelle 250 Reichstaler zu entnehmen. Die Gemeinde Pützborn steuerte ebenfalls noch 300 Taler zum Neubau bei. Mit gleicher Post erhielt Dechant Eyden auch die Befugnis, die Kapelle zu weihen.
Der Neubau ging zügig voran und am Feste des hl. Hubertus, am 4.11.1788, benedizierte (= segnete) Dechant Eyden unter Teilnahme von vielen Leuten feierlich die neue Hubertuskapelle.
Die Pützborner Kapelle ist ein "einfacher geputzter Bruchsteinbau, im Lichten 6,98 m breit und mit dem dreiseitigen Chorabschluss 16,25 m lang. Beiderseits vier schlanke, rundgeschlossene Fenster in Hausteinfassung. Das Westportal mit einfacher Quaderarchitektur und Nischenaufbau. Über dem Westende ein vierseitiger geschieferter Dachreiter mit lang gezogener achtseitiger Haube. Innen eine gerade Holz-Lehmdecke mit Voute[1]." (Wackenroder)
Glocken läuten
Der große Kreuzweg wurde Anfang 1900 im Saarland gekauft. 1925, als Pützborn als letzte Filiale der Pfarrei Neunkirchen das Allerheiligste erhielt, schaffte es sich einen neuen Tabernakel an, dessen Tür aus getriebenem Messing besteht. Die Sakristei wurde 1933 angebaut.
1967 und 1978 kam es zu grundlegenden Restaurierungen und Renovierungen. Der Altar wurde gereinigt, vom Wurm befreit und neu gestrichen und die Malereien an der Decke, am Altar und an den Figuren stilgerecht ausgeführt. Eine elektrische Heizung wurde angeschafft, der gesamte Kapelleninnenraum gestrichen, der kalte Steinfußboden mit einem Holzbelag versehen und die unbequemen Sitzbänke mit einer Polsterung bedeckt.
Im Januar 1991 wurde in der Kapelle eine 1985 gebaute Orgel des Orgelbauers Heinz Wilbrand eingeweiht. Dieses Werk in massivem Eichenholz mit einer mechanischen Spiel- und Registertraktur ist eine einmalige Hausorgel mit Vollpedal, fünf klingenden und einem Bassregister.
Die erste bronzene Glocke aus der Kapelle von 1788 und der Inschrift "MARIA HEIßEN ICH" wurde 1943 zu Kriegszwecken aus dem Turm genommen und durch eine kleine Stahlglocke ersetzt. Als im März 1957 der alte wurmstichige und morsche Kirchturm abgebrochen und durch einen neuen Turm ersetzt wurde, beschaffte sich Pützborn ebenfalls eine neue Glocke, die von Glockengießer Mark, Brockscheid, gegossen wurde.
Sie trägt die Aufschrift: SANCTI ANTONI ET HUBERTE ORATE PRO NOBIS (Heilige Antonius und Hubertus bittet für uns), wiegt 120 kg, kostete 1500 DM und wird seit Juni 1983 elektrisch betrieben.
Diese– tagsüber leider geschlossene - Hubertuskapelle wurde nie ein Raub der Flammen und im Visitationsbericht (= Protokoll anlässlich eines Bischofsbesuches) von 1803 ist zu lesen, sie sei "ungemein schön". Zu diesem schmeichelhaften Urteil wird auch sicherlich die Bemalung im Inneren der Kapelle beigetragen haben. Die Schlichtheit und Einfachheit der Deckenmalerei zeugt von echter bäuerlicher Kunst. Auch der Altar ist typischer Bauernbarock, farbenfroh und formenreich, aber nicht aufdringlich und nicht überladen. Allerdings ist die Kapelle heute in die Jahre gekommen und bedürfte dringend einer Renovierung – innen wie außen!
Als 1803 die ehemalige Pfarrkirche „St. Lambertus“ in Steinborn zur Filiale degradiert und dafür die Filiale Neunkirchen zur neuen Pfarrei „St, Anna“ wurde, löste man anfangs Pützborn aus diesem Verbund und wies es der Dauner Nikolauskirche zu. Dagegen wehrten sich die Pützborner mit Erfolg, und bereits 1805 durften sie zu ihrer Pfarrei Neunkirchen zurück. Bis heute befindet sich die Filiale Pützborn in der Pfarrgemeinde St.Anna Neunkirchen (zusammen mit den Filialen in Steinborn und Waldkönigen) in der Pfarreiengemeinschaft Daun, die aus zwölf Pfarrgemeinden in 26 Orten besteht.
„Als großer Wundertäter Hubertus wird verehret“
So beginnt ein frommes Kirchenlied in dem alten Kölner Gesang und Gebetbuch von 1852 und fährt fort:
„Von Pilgern nah und ferne wird seine Hülf’ begehrt.
Die treu sich ihm befehlen schützt er vor Hundewut;
er schützt auch unsre Seelen vor Satans Höllenglut!“
Der heilige Hubertus genoss stets hohe Verehrung bei der Bevölkerung des Dorfes Pützborn, in der Pfarrei Neunkirchen-Steinborn und im weiten bäuerlichen Umland. Er war ein Heiliger mit hoher Bedeutung für die Landwirte, die zu diesem Heiligen flehten und ihn um Hilfe bei menschlichen und tierischen Krankheiten baten, besonders bei Tollwut, Hunde- und Schlangenbiss.
In Pützborn wurde zumindest bis Ausgang des 18. Jahrhunderts der sogenannte "Hubertusschlüssel" aufbewahrt. Bauern, die tollwütige Tiere hatten oder von solchen gebissen worden waren, nahmen diesen Schlüssel, erhitzten ihn glühend und stempelten damit Tier und Wunde, um so durch die Fürsprache des Heiligen Hubertus Heilung zu finden. Da dieser Schlüssel im heutigen belgischen Kloster "St. Hubert" gesegnet worden war und ihm so Wunderkräfte zugeschrieben wurden, entwickelte sich Pützborn seinerzeit zu einem kleinen Wallfahrtsort. Zahlreiche Bauern kamen von weit her, opferten und beteten. Wo dieser eiserne "Hubertusschlüssel" verblieben ist, weiß keiner. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er bei dem Eindringen der französischen Revolutionäre (1794) in die Eifel und in die Pfarrei Steinborn verloren gegangen sein.
Apostel der Ardennen
Hubertus entstammte einem Adelsgeschlecht und wurde um 655 in Toulouse in Frankreich geboren. Seine Jugend verlebte er in Paris am Hofe Theoderichs, wo er das Amt eines Pfalzgrafen bekleidete. In dieser Eigenschaft zog er sich den Neid und die Feindschaft eines mächtigen fränkischen Hausmeiers (= vergleichbar mit einem Regierungspräsidenten) zu. Hubert musste nach Metz an den Hof des Kaisers Pippin flüchten. Dort heiratete er Floribana, die Prinzessin von Löwen, die ihm den Sohn Floribert gebar, der später sein Nachfolger als Bischof von Lüttich wurde. Bei dessen Geburt starb Huberts Frau. Daraufhin zog er sich von allen Ämtern zurück, lebte sieben Jahre als Einsiedler in den Wäldern der Ardennen und ernährte sich durch die Jagd.
In dieser Zeit wurde er ausgebildet und erhielt theologische Studien von dem berühmten Bischof Lambert. Hubert wurde von diesem zum Priester geweiht und wirkte als Glaubensbote in Brabant und den Ardennen. Bis heute gilt er deshalb als der "Apostel der Ardennen".
705 wurde Bischof Lambert ermordet. Hubert wurde sein Nachfolger und Bischof von Tongern-Maastricht. Er galt als umsichtig und milde. Bei einer Hungersnot rettete er Tausende Menschen vor dem Tod.
Am 24. Dezember 717 ließ er die Gebeine des mittlerweile heiliggesprochenen Lambert nach Lüttich übertragen und verlegte ebenfalls seinen Bischofssitz dorthin, wo er an der Stelle, an der sein Lehrer Lambert ermordet worden war, die heutige Kathedrale erbauen ließ.
Hubertus starb am 30. Mai 727 in Tervuren bei Brüssel in Belgien. Am 3. November 743 fand die feierliche "Erhebung" seiner Gebeine statt, um sie oberirdisch vor dem Hauptaltar zu bestatten. Ein solcher Akt war bis in das 10. Jahrhundert die übliche Form der Heiligsprechung. Seitdem wird der Hubertustag am 3. November gefeiert.
Kreuz im Geweih
82 Jahre später erbaten die Mönche des bis dahin unbedeutenden Klosters Andain die Reliquien des Heiligen. Sie versprachen sich davon ein Aufblühen ihrer Gemeinschaft. Am 30. Mai 825 wurden die Gebeine in die Benediktinerabtei überführt, die sich bald den Namen ‚St. Hubertus in den Ardennen‘ gab, ein bis heute bedeutender Wallfahrtsort. Während der Französischen Revolution (1794) wurden die Reliquien gestohlen und sind bis heute nicht auffindbar.
Die älteste Lebensbeschreibung weiß nichts von einer Beziehung des Heiligen zu Jagd und Jägern. Noch viel weniger erwähnt sie die dem Hubertus zugeschriebene Erscheinung des Hirschen mit einem Kreuz zwischen den Geweihstangen. Nachweisbar ist aber, dass man zum Ende des 10. Jahrhunderts im Kloster Heilung von der Tollwut suchte.
Die Legende von dem Hirsch mit dem leuchtenden Kreuz zwischen den Geweihstangen ist bereits um 100 nach Christus nachweisbar, bezieht sich aber auf Placidus, einen Feldherr Kaiser Trajans (98-117). Als er einen kapitalen Hirsch verfolgte, blieb das Tier plötzlich stehen und wandte sich um. Placidus erblickte zwischen dem Geweih ein leuchtendes Kreuz. Er sah darin ein Zeichen des Himmels und ließ sich sowie seine Frau und seine Söhne taufen. Getauft wurde Placidus auf den Namen Eustachius.
Diese Legende wurde im 11. Jahrhundert auf den hl. Hubertus übertragen und noch etwas ausgeschmückt. Danach habe sich Hubertus, nachdem seine Frau Floribana im Kindbett gestorben war, in weltliche Vergnügungen gestürzt, um seinen Schmerz zu vergessen. Als er an Karfreitag jagte, erschien ihm ein Hirsch mit einem goldenen Kreuz zwischen dem Geweih und fragte Hubertus: "Hubertus, ich erlöste dich und dennoch verfolgst du mich!" Tief betroffen habe daraufhin Hubertus den Bischof Lambert aufgesucht, sich bekehrt und zum Priester weihen lassen.
Anschauliche Schnitzarbeit
Der hölzerne Hochaltar wurde um 1710 von Pfarrer Lamberti angeschafft und ist in seiner schlichten Schönheit noch heute unverändert erhalten. Die Türabschlüsse, die zugleich als Beichtstuhl dienen, sind aus derselben Zeit. Auf der Mitte des Gesimses stehen hölzerne Vasen mit hohen Blumendekorationen. Auf dem Altar befinden sich die Figuren der Heiligen Hubertus, Blasius und Antonius. Der schräg zurückspringende Altartisch zeigt auf der Vorderseite seines Sockels eine einfache Szene aus der Hubertuslegende.
Diese Schnitzarbeit - vermutlich das Werk eines Eifeler Holzschnitzers - zeigt, wie der hl. Hubertus dem Hirsch begegnet. Erstaunt kniet der Heilige mit gefalteten Händen nieder vor diesem sichtbaren Zeichen Gottes, das Kreuz zwischen dem Geweih des Hirschen. Auch die Jagdhunde kauern kniend auf dem Boden. Nicht recht begreifend schaut der eine Hund zurück zu seinem Herrn, der doch ansonsten so leidenschaftlich der Jagd frönte, während der andere Jagdhund zum Hirsch starrt. Aus den Wolken brechen Sonnenstrahlen, gleichsam den Geist von Hubertus erleuchtend und ihn für seine nunmehr neue und wichtigere Aufgabe im Weinberg Gottes bereit machend. Diskret hält sich der Diener im Hintergrund zurück, in seiner Hand die Zügel des stolzen Rosses und wird so Zeuge dieses "Wunders".
Ein untergegangener Brauch
Alois Mayer, Pützborn
Seit Jahrtausenden brubbelt und sprudelt in der Eifel, besonders im Kreis Daun, aus Spalten und Klüften der Erdkruste kohlensäurehaltiges Wasser, Zeugnis einstiger vulkanischer Tätigkeit.
»Thriasan« nannten die Kelten diese Quellen, die späterhin die römischen Legionäre erquickten, welche dann dankbar ihren Wassergöttern manche Münze opferten; Drees nennen heute die Eifler diese Sauerbrunnen, loben das erfrischende Wasser, das man noch in Steinkrügen auffängt und als kühles Labsal genießt. Ganze Industrien nutzen diesen vulkanischen Segen und tragen so dazu bei, den Namen Vulkaneifel in der Welt bekannt zu machen. Vor Jahrzehnten schätzten Eifelbauern dieses sprudelnde Wasser noch viel mehr als heute. In blaue Steinkrüge abgefüllt, löschte es den Durst an heißen Arbeitstagen; sehr begehrt war es beim Brotbacken oder als kostenloser Natronersatz bei den beliebten Kuchenfladen oder dem Pfannkuchen aus Heddelischmehl (Buchweizen).
Wen wundert's also, wenn sich um diese Naturgabe ein sinnvolles Brauchtum entwickelte, welches aber nach der Jahrhundertwende in Vergessenheit geriet und nicht mehr gepflegt wurde: »Der Drees wurde geputzt«.
Am Sonntag vor Pfingsten trafen sich die schulentlassenen Mädchen des Dorfes Pützborn, bei Daun, am beliebten Drees. Mit Ginsterbesen und Putzlappen wurde die Quelle gereinigt, die vom hohen Mineralgehalt des Sauerbrunnens rostig gefärbten Steinplatten geschrubbt, Unkraut gerupft, Rohre gescheuert, die Sitzbank blankgerieben.
Lustiger Gesang und munteres Geplapper erfüllte die Luft. Gegen Ende der Säuberung brach man einen Strauß vom grünen Maien, flocht bunte Blumen darunter und schmückte damit den Born, der so reichlich sich verschüttete und rostrot im nahen Bach einmündete. Mit feierlicher Handlung streute dann ein Mädchen eine Hand voll Salz ins Wasser, eine wertvolle Gabe, nicht wissend, daß sie damit einer alten Gepflogenheit folgte, den Quellgöttern zu opfern.
»Ihr seid das Salz der Erde« sagt die christliche Kirche, die das Salz seit jeher als Symbol der Weisheit und der sittlichen Unversehrtheit ansieht. Sie verwendet heute noch geweihtes Salz bei der Taufe und bei der Weihe des Weihwassers. Am Dreikönigs- und Blasiustag wird Salz gesegnet für Menschen und Haustiere.
Nach dieser Handlung zog man singend durchs Dorf, hocherhoben am Besenstiel einen Strauß aus Buchengrün, geschmückt mit bunten Bändern, klopfte an die Holztüren der kleinen Häuser an und erbettelte sich Eier als Lohn für die getane Arbeit.
Die Woche verging und der Pfingstsonntag sah dann die jungen Burschen in den Wald eilen, dort Buchenäste, den Mai, hauen und sie vor die Häuser der Bauern stellen. Besonders schön prangte mancher Mai vor der Tür der Geliebten. Am Dorfbrunnen aber wurde dann ein extra großer Baum aufgestellt, an dem im warmen Frühlingswind bunte Streifen und Fähnchen lustig flatterten. Den Lohn, erheischte Eier, sammelte man schließlich von Haus zu Haus und legte ihn vorsichtig in mit Stroh gefüllte Weidenkörbe. Am Pfingstmontag trafen sich nun alle Burschen und Mädchen am Brunnen, rund um den großen Maibaum. Eine Ziehharmonika spielte zu Gesang und Tanz auf; die gesammelten Eier wurden in eisernen Pfannen über dem offenen Feuer gebacken und gemeinsam verzehrt. Die Stimmung war groß, das Leben schön. Die Branntweinflasche machte ihr? Runde, lockerte Stimme und Stimmung. Der scharfe Schnaps trug aber auch dazu bei, dass manches Fest durch Eifersüchteleien ein allzu rasches Ende fand und das friedvolle Miteinander in das Gegenteil verkehrte, was dann leider letztlich zum Ende des Brauchtums, dem Dreesputzen, führte.
Erinnerungen von Fritz Gehendges
Erinnerungen an ein Dorf
Friedrich Gehendges
Warum eigentlich? Noch viele Jahre danach stellt sich ein heute Vierzigjähriger, ein ehemaliger Pützborner Junge, immer wieder die gleiche Frage, wenn er an seine Schulzeit in Gerolsteins St.-Matthias-Progymnasium zurückdenkt. Warum stieg eigentlich regelmäßig und unbarmherzig ein beklemmendes Gefühl, eine Art Scham in dem Jungen auf und trieb ihm die Röte ins Gesicht, wenn er vor versammelter Mannschaft nach seiner Herkunft gefragt wurde? Wie beneidete er seine Klassenkameraden, wenn diese bei gleicher Gelegenheit mit stolzem Unterton Städte wie Trier, Kyllburg oder das damals noch weit entfernte Völklingen als ihre Heimatorte verkünden konnten! Hätten doch die Lehrer ein Einsehen und fragten nicht immer nach dem Wohnort, sondern nach dem Ort der Geburt! Dann wäre die Angelegenheit weniger peinlich, da man in diesem Falle ebenso selbstbewußt Daun ins Feld führen könnte.
Daun! Ein Begriff, den zu kennen, man jedem einigermaßen in heimatlicher Geografie bewanderten jungen Menschen der fünfziger Jahre unterstellen durfte. Aber Pützborn? Ganz schlimm kam es über den nach seiner Herkunft Gefragten, wenn er der Deutlichkeit halber zum Buchstabieren des Ortsnamens aufgefordert wurde und eine kurze Lagebeschreibung dieses wohl nebensächlichsten Platzes in der Welt gegeben werden mußte. Selbst Dauner Mitschüler schienen die Seelenqualen eines Dorfjungen in fast sadistischer Weise zu genießen und hatten wer will es Kindern verdenken schon vergessen, daß noch wenige Jahre zuvor ihre Eltern vor dem Hunger der Nachkriegszeit gerade in solche Dörfer wie Pützborn flüchteten.
Und heute? Aus diesem damals so geschmähten Nest ist wirklich ein »Nest« im wahrsten Sinne des Wortes geworden, in dem Dauner Bürger in zunehmender Zahl Zuflucht, Ruhe, Geborgenheit und nicht zuletzt jene Wärme suchen, die nur ein Nest bieten kann. Dreißig Jahre danach ist Pützborn ein begehrter Wohnplatz für Stadtmenschen geworden. Der ehemalige Pützborner Junge aber wohnt inzwischen in einer Kleinstadt, die sich selbstbewußt das »Tor zwischen Eifel und Mosel« nennt und diese Rolle überzeugend spielt. Er fühlt sich wohl in dieser aufstrebenden Kleinstadt, die ihm zur zweiten Heimat geworden ist; sein Dorf Pützborn aber sieht er nach zwanzig Jahren der Abwesenheit mit ändern Augen. Heute weiß er, daß die Kinder- und Jugendjahre im Dorf zwischen Warth, Kalk und Gönnerscheid zu den glücklichsten seines bisherigen Lebens gehören und auch damals nicht der geringste Anlaß gegeben war, die Herkunft aus der von anderen abschätzig belächelten Atmosphäre eines kleinen Dorfes nur zurückhaltend zuzugeben.
Bei vielen seiner Besuche im elterlichen Haus am Pützbach führte ihn in den vergangenen Jahren ein Spaziergang durch die Straßen und Pfade seines Heimatortes und ließ in ihm Erinnerungen an Kindertage wach werden und Vergleiche zwischen damals und heute anstellen. Vieles hat sich verändert, und die Menschen erst recht die Kinder , die ihm auf diesen Wegen begegneten, waren ihm unbekannt. Es war nicht mehr so wie früher, daß man eine auch nur in der Ferne auftauchende Gestalt bereits von weitem erkannte und sich während der letzten Schritte vor der Begegnung schon eine freundliche Bemerkung zurechtlegte, mit der man den anderen zu grüßen gedachte. Selbst einem Ur-Pützborner wie dem Vater des Schreibers dieser Zeilen war es trotz geistiger Regsamkeit in den letzten Jahren seines Lebens nicht mehr möglich, jede inzwischen ortsansässige Person zu identifizieren, wenn er seinen Sohn auf dessen Wegen in Jugenderinnerungen begleitete.
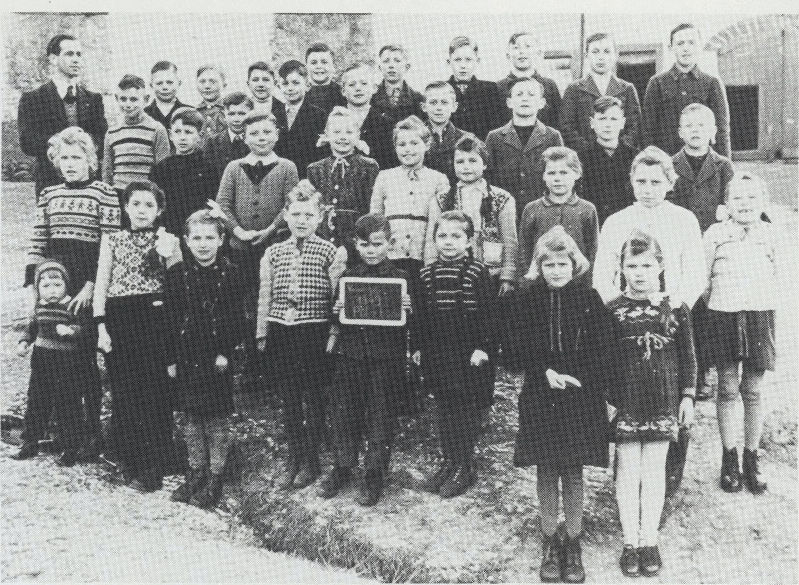
Die Volksschule Pützborn 1949 eine einklassige Zwergschule mit ihrem Lehrer Alois Hermes. Diese Generation wurde Augenzeuge des Wandels ihres kleinen Dorfes mit allen Vor- und Nachteilen.
So manches hat mein Dorf inzwischen von seinem ursprünglichen Charakter eingebüßt. Verlorengegangen sind vor allem das den Dorfbewohnern früher eigentümliche Zusammengehörigkeitsgefühl, das Sich-Kennen, das Sich-Mögen und Sich-Hassen, das Wissen um Vorgänge in jedem entlegenen Dorfwinkel und in jedem Haus und das nicht immer nur von Neugier geprägte Interesse am Geschick der Mitmenschen.
Die Atmosphäre ist steril geworden, nüchtern und unpersönlich. Frei von Schmutz sind die Dorfwege, die sich heute »Straßen« nennen dürfen und ein Bild bieten, das in meinen Kindertagen noch mancher Stadt zur Ehre gereicht hätte. Straßenschilder mit oft nichtssagenden Benennungen haben mundartliche Namen ersetzt, für die es keiner Beschilderung bedurfte, da jeder die »Milmet«, die »Schaft«, das »Schläfjen« oder die »Holl« kannte. Gerade der Staub der damals noch nicht befestigten Dorfstraßen, der sich unmerklich, aber unerbittlich bei jedem Gang durchs Dorf in Kleider und Haare hängte, mag im nachhinein wie ein Symbol für das Einbezogensein des Menschen in sein Dorf wirken.
Und dann kam der Abend, an dem zum ersten Male nach dem Kriege sich das blau-weiße Licht der Neonröhren über Wege und Höfe ergoß zweifelsohne ein weiterer Fortschritt. Aber entfremdete die nächtliche Taghelle die Menschen nicht wiederum ein Stück von »ihrem« Dorf? Wußte nicht bislang jeder nächtliche Heimkehrer auch bei völliger Dunkelheit erfolgreich allen vertrauten Schlaglöchern, Pfützen und Stolpersteinen auszuweichen, denen man nun mit einem Male keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken brauchte? Ebenso sicher umging man zuvor auf den Höfen die Jauchepfützen, die Misthaufen, die abgestellten Ackerwagen und Holzstapel, wenn man mit oder ohne besonderen Anlaß einmal zur Nachtzeit einen Mitbürger aufsuchte. Das dumpfe Licht aus den noch nicht mit Rolläden gesicherten Fenstern bot auf den letzten Schritten sicheres Geleit zu der in den meisten Fällen trotz der Dunkelheit noch unverriegelten Haustür.
Solche Wege wurden oft unternommen in Zeiten, als das Fernsehen noch nicht alt und jung in die eigenen vier Wände bannte und jeder unverhoffte Besucher eine willkommene Abwechslung in den langen Abendstunden darstellte. Oft konnte dann kurz darauf ein Passant hinter vorgezogenen Vorhängen heraus jenes eigentümliche Geraune, Klopfen und Klatschen vernehmen, das ihm verriet, daß man sich wieder einmal zu einer der ungezählten Skatrunden zusammengefunden hatte. Es bedurfte damals keines Vereins, um diese bevorzugte Art der Geselligkeit zu pflegen, bei der mit allem Ernst und mit äußerster Erbitterung um Zehntelpfennige gerungen wurde. Nur ganz selten kam einmal ein Skatbruder ungelegen, und oft war dann die Küche bis spät in die Nacht hinein von den »Kartendreschern« in Beschlag genommen. Keiner von denen nahm es übel, daß man die »gute Stube« nur an Sonn- und Feiertagen »in Betrieb« nahm, auch wenn die Küche mit dem eben erst abgeräumten und noch un-gespülten Tischgeschirr im Spülbecken und den noch im engen Raum treibenden Essensgerüchen die ganze Zusammenstellung des bäuerlichen Abendmahls preisgab.
Heute ist man im Umgang miteinander reservierter geworden. Mit den »Kärtern« von damals, mit Treinen Juppes, mit Mayer Juppes, Schreiner Alois, Schreinisch Meerten, Leisbez Meerten, den Schmidtjungen und anderen Altersgenossen ist inzwischen die letzte Generation ins Mannesalter getreten, die sich noch weitgehend durch natürliche, dörfliche Unkompliziertheit in ihren mitmenschlichen Beziehungen auszeichnete.
Vorbei ist es auch mit einer anderen Idylle des Dorflebens. Die damaligen Dorfväter im Gemeinderat verfolgten durchaus ein löbliches Ziel, als sie Planung und Bau eines Gemeindehauses in Angriff nahmen. Was dieser nützlichen Einrichtung jedoch zum Opfer fiel, war die von Bäumen eingerahmte, altersschwache Bank auf dem Dorfplatz. Hatten sich hier an lauen Sommerabenden erst einmal einige wenige eingefunden, so dauerte es in den meisten Fällen nicht lange, bis sich ihre Zahl binnen kurzem auf die Mindeststärke eines dörflichen Gesangvereins erhöht hatte. Dann fehlte nur noch Scheez Hermann, bei dem es nicht vieler Überredungskunst bedurfte, um ihn mit seinem Akkordeon aus dem nahen Hause zu locken. Wie anders doch als das Geknatter von Mopedmotoren hörten sich dann die unermüdlich und ohne Proben in mehrstimmigem Gesang in den Abendhimmel aufsteigenden, damals noch jung und alt vertrauten Volksweisen an! Selbst im entferntesten Dorfwinkel konnte man ihnen lauschen, da der Lärm unserer motorisierten Zeit seinen Einzug in das kleine Dorf noch nicht gehalten hatte. Dann traten nach getaner Arbeit auch »Op der Mill« und in der »Hohnerjaß« die Menschen aus ihren Türen, setzten sich auf die unverzichtbare Bank vor ihrem Hause und summten die an ihr Ohr dringenden Melodien mit. Nächtliche Ruhestörung? Aber nein! Solche Liederabende zeugten vielmehr von der menschlichen Nähe in einer noch intakten Dorfgemeinschaft. Das einfühlsam und aus tiefster Überzeugung vorgetragene »Kein schöner Land« beschloß in der Regel solche Stunden der Geselligkeit und räumte schließlich mit »Nun, Brüder eine gute Nacht!« dem Abendfrieden sein Recht ein.
Hin und wieder trieb es die jungen Leute auch über die Grenzen des eigenen Dorfes hinaus. Hatte man sich wieder einmal »Auf der Kreuzung« oder »Auf der Bank« zu einer kleinen Runde zusammengefunden, so überließ man es oft einer hochgeworfenen Schirmmütze, mit ihrem Fallen die Wahl des Zielortes vorzunehmen. Dann machte man sich zu Fuß auf, um für einige Stunden die Nase in eine Neunkirchener, Dauner, Gemündener oder Oberstadtfelder Gastwirtschaft zu stecken. Immer mit Gesang, oft auch mit Hermanns Musikbegleitung, war selbst der Hin- und Rückweg eine sinnvoll genutzte Zeit. Auch die sonntagnachmittäglichen Spaziergänge niemand hätte damals an den Begriff des »Volkswanderns« gedacht durch Wald und Feld standen hoch im Kurs bei den Jugendlichen, als Mofas, Mopeds und Autos noch nicht zum Einzelgängertum verleitet hatten.

Unterhaltung wurde den jungen Dörflern damals noch nicht in ue, Heutigen verwirrenden Fülle geboten. Doch verstand man es recht gut, sie sich selbst auf herzerfrischende Weise zu verschaffen.
Unaufhaltsam aber hielt die neue Zeit ihren Einzug auch in mein Dorf im Tal des Pützbaches. Es änderte sich das Gesicht des Dorfes, es änderten sich die Ziele seiner Bewohner und die Menschen selbst. Wenn früher noch der kleine Laden von »Weiler Bäb« als Fundgrube für alle Dinge des bescheidenen täglichen Bedarfs ausreichte, so nahm bald ein Supermarkt diesen Platz ein und befriedigte auf verlockende Art die immer weiter steigenden Ansprüche. Grauschwarzer Asphalt hat Staub und Steine aus Jugendtagen für alle Zeiten unter sich begraben. Der von ungezählten Generationen genutzte Dorfplatz ist zu einer mit vorfahrtregelnden Schildern ausgestatteten, innerörtlichen Straßenkreuzung geworden. Er wird von dem wohlstandverkündenden Gemeindehaus beherrscht, das an Stelle des alten Schulgartens getreten ist, vor dem zwischen Bäumen »die Bank« zum Zusammensein einlud. Verstummt ist auch das vielstimmige Kinderrufen, das allmorgendlich und mittags vom Schulhof herüberdrang. Es gibt den Lehrer nicht mehr, vor dem man sich respektvoll hinter Mauerecken verdrückte, wenn er sich auf dem Weg durchs Dorf befand, und demman sich außerschulisch nur an dessen Namenstagen bei einem abendlichen Ständchen zu nähern wagte. Der Pützbach, früher ein Lieblingsaufenthalt der Dorfkinder, ihr »Schwimmbad« und »Anglerparadies«, schlängelt sich nicht mehr nach Belieben in zahlreichen Windungen am Dorf vorbei, sondern ist von allem unnötigen Gestrüpp befreit und in ein gemachtes Bett gezwungen. Mein Dorf hat die markantesten Züge seines Wesens dem Fortschritt geopfert: die mitmenschliche Nähe und die Nähe der Natur.
Was aber hat es dagegen eingetauscht? Ohne Zweifel den Menschen im kleinen Dorf, das sich heute »Stadtteil« nennt, geht es wirtschaftlich gut. Die Häuser sind schmuck verputzt, die Misthaufen verschwunden, die Hofflächen säuberlich aufgeräumt, die vor den Häusern geparkten Autos zeugen von Wohlstand und Aufgeschlossenheit. All dies sei ihnen von Herzen vergönnt! War aber der Preis, zu dem man diesen Errungenschaften Einlaß gewährte, nicht letztlich doch sehr hoch?
Die heutige Jugend, die damit heranwächst, wird nichts vermissen. Die Generation davor aber denkt oft noch gerne auch an »ärmere« Zeiten zurück, als sie sich in ihrem kleinen »Nest« geborgen wußte. Und fragt man mich heute nach meiner Herkunft, so ergötze ich mich regelmäßig an den neidvollen Blicken so manchen Städters, wenn ich ihm mein Dorf nennen darf. Selbst das Buchstabieren seines Namens und die Beschreibung seiner Lage bereitet mir Genuß. So ändern sich die Zeiten und die Menschen!

Ortsvorsteher
06592-7656

Webmaster
06592-985441
Kontakt:
Webmaster Tel: 06592-985441
Alte Rossgasse
54550 Daun-Pützborn
Mail: henry-blum@web.de
Kontakt:
Ortsvorsteher
Johann Strunk
Alte Rossgasse
54550 Daun-Pützborn
Mail: daunerhennes@web.de
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com

